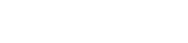Bevor sich der Herbst mit großen Schritten nähert, hatten wir bei einer intensiven Plenarwoche in Düsseldorf noch einmal das schönste Sommerwetter. Politisch stand diese Plenarwoche vor allem unter dem Eindruck der zurückliegenden Kommunalwahl sowie dem nun begonnenen Prozess zur Aufstellung des Landeshaushaltes 2026. Was mir in dieser Woche besonders wichtig war, lesen Sie wie gewohnt hier:
Landeshaushalt 2026 eingebracht
Die Landesregierung hat am Mittwoch den Haushalt für 2026 in den Landtag eingebracht. Der Entwurf sieht für das kommende Jahr Ausgaben in Höhe von rund 112,2 Milliarden Euro vor. Bildung, Sicherheit und Gesundheit stehen weiterhin ganz oben auf der Agenda, ebenso wie Investitionen in Infrastruktur und Zukunftstechnologien. Trotz der angespannten wirtschaftlichen Lage setzt diese Koalition mit einer klaren Linie aus Investieren, Priorisieren und Konsolidieren deutliche Zeichen. Mit diesem Haushalt zeigen wir: Wir investieren dort, wo es am meisten zählt. An erster Stelle stehen unsere Kinder. Darum geben wir so viel Geld für Bildung aus wie noch nie. Mehr als jeder dritte Euro im Landeshaushalt fließt in Kitas, Schulen und Hochschulen. Ein Blick auf die Entwicklung zeigt, wie stark die Mittel gewachsen sind: Als das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) 2008 in Kraft trat, standen für die Kitas 875 Millionen Euro zur Verfügung. 2026 werden es sechs Milliarden Euro sein – noch einmal 370 Millionen Euro mehr als in diesem Jahr. Auch das Personal ist deutlich verstärkt worden: So viele Fachkräfte wie heute gab es im Kita-System noch nie. 2026 stehen fast 760.000 Kita-Plätze bereit, 22,5 Prozent mehr als vor zehn Jahren. Und: Die letzten beiden Kita-Jahre bleiben beitragsfrei – anderslautende Behauptungen sind falsch.
Auch an den Grundschulen geht es voran. 2026 überschreiten wir erstmals die Marke von einer halben Million Plätzen im Offenen Ganztag. Dafür stellen wir rund eine Milliarde Euro bereit. Und weil auch hier Falschmeldungen kursieren: Prüfungen im herkunftssprachlichen Unterricht ersetzen keine Klassenarbeiten im regulären Unterricht. Für unsere Hochschulen sieht der Haushalt 2026 zusätzlich rund 300 Millionen Euro vor. Damit geben dem wissenschaftlichen Nachwuchs mehr Perspektiven.
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Sicherheit. Jedes Jahr beginnen 3000 neue Polizeianwärter ihre Ausbildung. Außerdem schaffen wir zusätzliche Stellen bei den Staatsanwaltschaften. So wächst die Handlungsfähigkeit von Polizei und Justiz.
Und auch unsere Kommunen stärken wir nachhaltig. Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage gehen wir die Altschuldenlösung des Landes an. In den kommenden 30 Jahren summiert sich die Unterstützung auf 7,5 Milliarden Euro. Damit gewinnen die Städte und Gemeinden Planungssicherheit und mehr Spielraum, um vor Ort investieren zu können. Dieser Haushalt macht deutlich: wir reden nicht nur, wir handeln.
Aktuelle Stunde zur frühkindlichen Bildung
Was wir heute in unsere Kinder investieren, entscheidet über die Zukunft unseres Landes. Frühkindliche Bildung ist eine unserer größten Aufgaben – deshalb geben wir Rekordsummen für sie aus.
Während die Opposition mit Falschbehauptungen und Panikmache nach parteipolitischen Geländegewinnen sucht, stabilisieren wir das System. Zwei Dinge bleiben unverändert: Die beiden Kita-Jahre in NRW sind und bleiben beitragsfrei. Und noch nie haben so viele Fachkräfte in unseren Kitas gearbeitet wie heute. Aber offensichtlich reicht das trotzdem nicht, weshalb wir grundsätzlich an das KiBiz heranmüssen. Und diese Novelle bereiten wir aktuell vor, im Dialog mit Kommunen, Kirchen und freien Trägern, für eine Betreuung, die Eltern und Kindern mehr Verlässlichkeit bietet.
Auch in den kommenden Jahren halten wir Kurs: 2025 fließen erneut rund 5,6 Milliarden Euro in die frühkindliche Bildung, 2026 steigt die Summe auf knapp 6 Milliarden Euro. Beim Platzausbau investieren wir ebenfalls Rekordsummen. Heute stehen rund 760.000 Plätze zur Verfügung – 22,5 Prozent mehr als vor zehn Jahren. Wir haben die Trägeranteile reduziert und den Landeszuschuss erhöht – kein Bundesland trägt einen größeren Anteil als Nordrhein-Westfalen.
Und wir gehen weiter: Wir sichern die Sprach-Kitas und das Kita-Helfer-Programm ab und unterstützen damit unsere Fachkräfte. Denn frühkindliche Bildung braucht nicht nur Geld, sondern auch Menschen, die jeden Tag Verantwortung übernehmen. Wir sind den Betreuerinnen und Betreuern dankbar, die jeden Tag ihr Bestes geben, um unsere Kinder auf ihrem Weg in die Zukunft zu begleiten. Wir stehen für Qualität, Verlässlichkeit, Stabilität und Beitragsfreiheit – für die Familien in unserem Land und für die Zukunft Nordrhein-Westfalens.
Vier Millionen Euro für Kunst und Kultur in kommunalen Musee
Kulturministerium fördert Ausstellungen, Ankäufe, Restaurierungen, Provenienzforschung und Kunstvereine
Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft teilt mit:
Die Kunstmuseen in Nordrhein-Westfalen sind lebendige Schaufenster großartiger Kulturschätze. Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen unterstützt die Kunstmuseen bei Ausstellungsprojekten, Ankäufen sowie Restaurierungsvorhaben und fördert auch die Kunstvereine. Zudem geht das stark nachgefragte neue Förderprogramm Provenienzen NRW im Jahr 2025 in seine zweite Runde. Insgesamt stärkt das Kulturministerium im Jahr 2025 so mit mehr als vier Millionen Euro die Bildende Kunst im Land.
Kulturministerin Ina Brandes: „Sammeln, bewahren, erforschen und vermitteln – das sind die Kernaufgaben unserer Museen. Mit der Unterstützung bei außergewöhnlichen Ausstellungsvorhaben, Restaurierungen und Ankäufen sowie der Förderung der Provenienzforschung stärken wir unsere Museen als Schatzkammern unseres kulturellen Erbes und machen sie noch attraktiver – auch für Menschen, die noch nicht zum Stammpublikum unserer Museen zählen.“
Ausstellungen
Insgesamt 36 Ausstellungsprojekte von überwiegend kommunalen Kunstmuseen fördert das Land Nordrhein-Westfalen mit mehr als zwei Millionen Euro; 19 der Projekte werden dabei bis ins kommende Jahr hinein der Öffentlichkeit präsentiert. Die Bandbreite reicht von Ausstellungen der Kunst der Moderne wie etwa „In aller Freundschaft! Heinrich Campendonk: Ein blauer Reiter im Deutschen Werkbund“ im Gustav-Lübcke-Museum Hamm über die im Lehmbruck Museum in Duisburg gezeigte Schau zu Jean Tinguely und Eva Aeppli bis hin zu „Light-Land-Scapes“, einem Projekt des Zentrums für internationale Lichtkunst in Unna. Das Josef Albers Museum Quadrat in Bottrop widmet ab September dem amerikanischen Land Art-Künstler Robert Smithson eine umfangreiche Einzelausstellung mit Werken, die in den 1960er-Jahren unter anderem im Ruhrgebiet entstanden. Auch das Kölner Museum Ludwig blickt mit seiner Ausstellung „5 Freunde“ ab Oktober nach Amerika: Das gemeinsam mit dem Museum Brandhorst in München konzipierte Projekt gilt John Cage, Merce Cunningham, Jasper Johns, Robert Rauschenberg und Cy Twombly. Mit William Kentridge zeigt das Museum Folkwang in Essen seit September einen der einflussreichsten und wichtigsten zeitgenössischen Künstler des afrikanischen Kontinents. Von November bis März des kommenden Jahres präsentiert das Kaiser Wilhelm Museum in Krefeld die erste große Retrospektive von Charlotte Perriand (1903-1999) in Deutschland. Die französische Architektin und Designerin gilt als eine der einflussreichsten Persönlichkeiten aus dem Umfeld Le Corbusiers und prägte maßgeblich das moderne Wohnen. Mit dieser Ausstellung stärkt das Museum seinen Schwerpunkt der Verbindung von Bildender und Angewandter Kunst.
Ankäufe
Zehn Kunstmuseen profitieren in diesem Jahr von der Ankaufsförderung des Landes Nordrhein-Westfalen. Insgesamt wurden Fördermittel in Höhe von rund 725.000 Euro vergeben. Dabei werden mit Hilfe der Neuerwerbungen Sammlungslücken geschlossen, neue Schwerpunkte gesetzt oder das Sammlungsprofil der Häuser gestärkt. So konnte das Museum Kurhaus Kleve ein Madonnen-Diptychon der zeitgenössischen Künstlerin Karin Kneffel erwerben. Die Kunsthalle Bielefeld erstand mit Unterstützung des Landes die Arbeit „Bunny Hex“ von Charline van Heyl aus dem Jahr 2020 und damit ein Hauptwerk dieser bisher in deutschen Museumssammlungen kaum vertretenen Künstlerin. Das Kunstmuseum Gelsenkirchen verstärkt mit der Plastik „Sonic Stone Dance“ von Haegue Yang seinen bedeutsamen Schwerpunkt kinetischer Kunst.
Restaurierungsprogramm
18 Restaurierungsprojekte erhalten im diesjährigen Förderzyklus Mittel vom Land Nordrhein-Westfalen. Insgesamt wurden mehr als 550.000 Euro an Museen vergeben, um sie bei dem Erhalt ihrer umfangreichen Sammlungsbestände zu unterstützen. Zu den von der Jury für eine Förderung ausgewählten Kunstwerken und Kunstobjekten gehören etwa das Gemälde „Familientriptychon“ von Franz M. Jansen aus dem Jahr 1908, das sich im Eigentum der Krefelder Kunstmuseen befindet, die kinetische Plastik „Chromointefèrence Mechanique“ von Carlos Cruz-Diez aus dem Kunstmuseum Gelsenkirchen sowie sechs Textilien aus Sumatra vom Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, die zur Sammlung des Von der Heydt-Museums in Wuppertal gehören.
Seit 18 Jahren setzt sich das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen mit der Restaurierungsförderung für die Museen des Landes ein. Über 300 Projekte konnten bereits von erfahrenen Restauratorinnen und Restauratoren umgesetzt werden. Mehr als 60 Museen und Sammlung haben so bisher von diesem bundesweit einzigartigen Förderprogramm profitiert.
Kunstvereine
Anders als die zumeist von den Kommunen getragenen Kunstmuseen sind Kunstvereine mehrheitlich gemeinnützige Einrichtungen, die vom ehrenamtlichen Engagement leben. Mit ihren Ausstellungen unterstützen sie in besonderer Weise Nachwuchskünstlerinnen und -künstler und leisten Vermittlungsarbeit. Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen stellt in der aktuellen Förderrunde 450.000 Euro zur Verfügung, um besondere Ausstellungsprojekte oder Maßnahmen zur Profil- und Programmförderung zu unterstützen.
Der in Düsseldorf beheimatete Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen zeigt in diesem Jahr die erste institutionelle Einzelausstellung des amerikanischen Künstlers Samuel Hindolo in Deutschland. Auch der Kunstverein Siegen präsentiert mit Werken von Yoel Pytowski erstmals eine Ausstellung dieses israelisch-französischen Künstlers hierzulande. Der Westfälische Kunstverein Münster erhält eine Förderung zur Entwicklung einer neuen Corporate Identity, um besser auf die Anforderungen der Digitalisierung und modernen Kommunikation eingehen zu können.
Provenienzen NRW
Im Jahr 2025 geht das Förderprogramm Provenienzen NRW in die zweite Runde. Auch in diesem Jahr können Institutionen wie Museen, Archive und Bibliotheken mit Hilfe des Landesförderprogramms Projekte der Herkunftsforschung umsetzen. Mit einem Fördervolumen von insgesamt knapp 315.000 Euro werden Projekte in 18 Einrichtungen unterstützt.
Unter den geförderten Projekten erhalten beispielsweise die Kunsthalle Recklinghausen und das LWL-Freilichtmuseum Detmold Fördermittel. Museen wie das Osthaus Museum Hagen oder die Universitäts- und Stadtbibliothek Köln erhalten finanzielle Unterstützung, um systematische Bestandsprüfungen über eine Projektförderung beim Deutschen Zentrum Kulturgutverluste (DZK) beantragen zu können. Darüber hinaus werden Projekte wie die Digitalisierung der Tagebücher zu den Ostasien-Reisen von Adolf und Frieda Fischer aus dem Museum für Ostasiatische Kunst in Köln unterstützt, die insgesamt Quellen und Ergebnisse der Provenienzforschung sichtbar machen
Grundstücksmarktbericht Nordrhein-Westfalen 2025: Der Markt erholt sich wieder
Das Ministerium des Innern teilt mit:
Im vergangenen Jahr wurden wieder mehr Immobilien und Grundstücke gekauft. Das geht aus dem jetzt veröffentlichten Grundstücksmarktbericht des Oberen Gutachterausschusses für das Jahr 2024 hervor. Demnach wurden in Nordrhein-Westfalen 113.144 Kaufverträge über bebaute und unbebaute Grundstücke sowie Wohnungs- und Teileigentum mit einem Geldumsatz von 40,72 Milliarden Euro und einem Flächenumsatz von 156,02 Quadratkilometer abgeschlossen. Dies sind circa 15.000 Kaufverträge mehr als im Vorjahr (+ 13 Prozent). Auch der Geldumsatz stieg gegenüber 2023 um circa 5,58 Milliarden Euro an (+ 16 Prozent).
Die Anzahl der Kaufverträge und der Geldumsatz nahmen in fast allen Teilmärkten durchweg stark zu. Eine Ausnahme stellen hier die Anzahl der Kaufverträge für Baugrundstücke im Gewerbe und Industrie sowie der Geldumsatz im Bereich der Baugrundstücke für den Geschosswohnungsbau dar. Die Preise fielen bei den bebauten Grundstücken leicht. Die Preise für die unbebauten Baugrundstücke für den Geschosswohnungsbau sowie für Wohnungseigentum blieben konstant. Unbebaute Baugrundstücke für den individuellen Wohnungsbau sowie für Gewerbe und Industrie erfuhren im Berichtsjahr eine Preissteigerung.
Die Anzahl der Kaufverträge für unbebaute Baugrundstücke nahm um 13 Prozent zu, der Geldumsatz erhöhte sich um sieben Prozent. Insbesondere der Geldumsatz bei Baugrundstücken für den individuellen Wohnungsbau wuchs an (+ 19 Prozent). Die Preisentwicklung war regional unterschiedlich (Bandbreite: – neun Prozent bis + fünf Prozent), blieb im landesweiten Schnitt jedoch unverändert. Die Preise von unbebauten Baugrundstücken für Gewerbe und Industrie sind nochmals leicht um vier Prozent gestiegen. Die Preise für den Geschosswohnungsbau blieben im Berichtsjahr konstant.
Erneut war ein leichter Preisanstieg in den Kreisen bei den landwirtschaftlichen Grundstücken (+ zwei Prozent) zu verzeichnen. Bei den forstwirtschaftlichen Grundstücken sind die Preise in den Kreisen unverändert geblieben.
Die Anzahl der Kaufverträge bei den bebauten Grundstücken ist insgesamt um 14 Prozent gestiegen, der Geldumsatz um 16 Prozent. Bei Ein- und Zweifamilienhäusern nahm er landesweit um 17 Prozent zu, während die Preise durchschnittlich um ein Prozent gesunken sind.
Die Anzahl der verkauften Eigentumswohnungen in Nordrhein-Westfalen erfuhr im Berichtsjahr eine Steigerung von + 16 Prozent, der Geldumsatz wuchs um 20 Prozent und die Preise verteuerten sich landesweit um ein Prozent.
Die höchsten Baulandpreise für individuellen Wohnungsbau in mittleren Wohnlagen werden in Düsseldorf mit 1.050 Euro/qm erzielt. Bodenpreise ab 650 Euro/qm finden sich in sechs weiteren Städten, hauptsächlich in der Rheinschiene. Dagegen kann in einzelnen rein ländlich strukturierten Gebieten, wie z.B. in der Eifel oder in der Region Sauer- und Siegerland oder Ostwestfalen/Lippe, der Quadratmeter erschlossenes Bauland in mittleren Wohnlagen noch für einen Preis von unter 50 Euro erworben werden.
Beim Wohnungseigentum (Erstverkauf in mittlerer Lage) wurden die höchsten Preise in Düsseldorf mit rund 7.350 Euro/qm, in Köln mit 6.740 Euro/qm, in Pulheim mit 6.640 Euro/qm und in Hürth mit durchschnittlich 6.200 Euro für einen Quadratmeter Wohnfläche gezahlt.
Diese und andere Daten sind dem Grundstücksmarktbericht Nordrhein-Westfalen 2025 (Berichtszeitraum 01.01.2024 bis 31.12.2024) zu entnehmen, der jährlich vom Oberen Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Land Nordrhein-Westfalen erstellt wird und das Ergebnis der Auswertung des Datenmaterials der örtlichen Gutachterausschüsse enthält. Er informiert umfassend und aktuell über Umsätze, Preise und Preisentwicklungen auf allen Grundstücksteilmärkten in Nordrhein-Westfalen.
Der Grundstücksmarktbericht Nordrhein-Westfalen sowie die dem Bericht zugrundeliegenden Grundstücksmarktdaten können unter www.boris.nrw.de kostenlos heruntergeladen werden.
Umweltzustandsbericht: Saubere Luft und erfolgreicher Artenschutz – Nordrhein-Westfalen steht dennoch vor großen ökologischen Herausforderungen
Das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr teilt mit:
Nordrhein-Westfalen hat beim Umweltschutz wichtige Fortschritte erzielt: Die Luft ist heute so sauber wie seit Generationen nicht mehr. Grenzwerte für Stickstoffdioxid und Feinstäube werden an allen Messstellen im Land eingehalten und auch die Treibhausgasemissionen sind zuletzt deutlich gesunken. Beim Artenschutz zeigen sich Erfolge durch die Rückkehr einst ausgestorbener Arten wie dem Seeadler, dem Lachs oder Fischotter, die sich durch gezielte Schutzprogramme, verbesserte Lebensräume und das Engagement vieler Ehrenamtlicher wieder ansiedeln. Diese positiven Trends zeigen, dass entschlossenes Handeln wirkt.
Doch der neue Umweltzustandsbericht für den Zeitraum 2020 bis 2024 macht auch deutlich: In anderen Bereichen stellen globale Entwicklungen die Länder vor zunehmende Herausforderungen. Die biologische Vielfalt nimmt weiter ab, der Flächenverbrauch ist nach wie vor hoch und Ewigkeitschemikalien belasten die Gewässer und Böden. Fachleute ordnen diese Belastungen in das Konzept der „planetaren Grenzen“ ein. Es beschreibt die ökologischen Leitplanken, innerhalb derer die Menschheit sicher leben kann. Sechs von neun dieser Grenzen sind inzwischen überschritten – mit Folgen auch für Nordrhein-Westfalen.
„Deshalb schreiben wir gerade die Biodiversitätsstrategie für Nordrhein-Westfalen in einem Konsultationsprozess fort, den es so in dieser Breite noch nicht gegeben hat. Der Handlungsdruck steigt, wir müssen der Klima- und Biodiversitätskrise auf vielen Feldern begegnen. Dafür liefert dieser Bericht eine Grundlage. Er zeigt, wo wir erfolgreich sind und wo wir noch stärker nachsteuern müssen“, sagt Oliver Krischer, Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr.
Nordrhein-Westfalen reagiert auf die Klimakrise mit ihren negativen Folgen im Vergleich zu anderen Bundesländern überdurchschnittlich engagiert im Nachhaltigkeitsrating. In Bereichen wie Umwelt, Klimaschutz und Biodiversität zeichnet sich das Land durch gute Noten aus und nimmt in der Klimaanpassung bundesweit eine Vorreiterrolle ein. Die hohe Bevölkerungsdichte und die große Anzahl an Menschen, die von Umweltauswirkungen betroffen sind, stellen dabei eine besondere Herausforderung dar.
Hintergrund: Der Umweltzustandsbericht
Der Umweltzustandsbericht Nordrhein-Westfalen wird nach dem Umweltinformationsgesetz Nordrhein-Westfalen in regelmäßigen Abständen vorgelegt. Er bündelt die zentralen Daten und Fakten aus den Mess- und Monitoring-Programmen des Landes sowie aus Forschungsarbeiten zu Luft, Wasser, Boden, Artenvielfalt, Klima und Ressourcen. Ziel ist es, den aktuellen Zustand der Umwelt umfassend darzustellen, Entwicklungen sichtbar zu machen und die Grundlage für politische Entscheidungen zu liefern. Der aktuelle Bericht betrachtet die Jahre 2020 bis 2024.
Klimawandel und Energie
Die durchschnittliche Jahresmitteltemperatur der vergangenen 30 Jahre ist in Nordrhein-Westfalen im Vergleich zum 30-Jahres-Durchschnitt zu Beginn der Aufzeichnungen um 1,7 Grad auf 10,1 Grad Celsius gestiegen. 2024 wurde mit 11,3 Grad Celsius ein neuer Rekord für das Jahresmittel in Nordrhein-Westfalen gemessen. Heiße Tage mit einer Höchsttemperatur über 30 Grad Celsius haben sich seit Anfang des 20. Jahrhunderts (1891 bis 1920) verdoppelt – von vier auf acht Tage. Die Zahl der Eistage mit einer Höchsttemperatur unter 0 Grad Celsius ging dagegen deutlich zurück – von 17 auf 11 Tage. Beim Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen zeigt sich indes eine positive Entwicklung in Nordrhein-Westfalen: Die Emissionen sind zuletzt stark gesunken – von 218 Millionen Tonnen 2022 auf 187,5 Millionen Tonnen 2023. Das liegt vor allem an Emissionsminderungen in den Sektoren Energiewirtschaft von 26 Prozent und Industrie von 5,9 Prozent, aber auch Haushalte und Kleinverbraucher reduzierten die Emissionen um 7,5 Prozent.
Luft und Lärm
2024 wurden landesweit an allen Probenahmestellen die Grenzwerte für Stickstoffdioxid und Feinstaub eingehalten. Smog-Alarme wie in den 1970er und 1980er-Jahren gehören damit endgültig der Vergangenheit an. Belastend bleibt dagegen der Lärm: Rund 2,3 Millionen Menschen in Nordrhein-Westfalen sind nachts potenziell gesundheitsschädlichen Geräuschimmissionen ausgesetzt, vor allem in Ballungsräumen.
Boden, Flächen und Grundwasser
Der Flächenverbrauch in Nordrhein-Westfalen bleibt hoch. Zahlen von 2022 zeigen, dass pro Tag 5,6 Hektar für Siedlung und Verkehr verbraucht wurden. Seit 2016 sind so rund 125 Quadratkilometer genutzt worden – die 1,2-fache Fläche des Nationalparks Eifel. Früh hat das Land Nordrhein-Westfalen mit der Bearbeitung von sogenannten PFAS-Fällen (per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen) mit Boden- und Grundwasserverunreinigungen begonnen. Eine Vielzahl dieser Fälle wird bereits saniert. Zudem gibt es immissionsbedingte Belastungen in Böden, so dass PFAS ein großes Handlungsfeld bleibt.
Der Eintrag von Schwermetallen in Böden wurde erheblich vermindert, und die Nitratbelastung des Grundwassers ist in Teilen des Landes rückläufig.
Gewässer
In den vergangenen Jahren wurde schon viel in den Gewässerschutz investiert. Beispielsweise konnten die Nährstoffbelastungen deutlich verringert werden. Nichtsdestotrotz bleibt es eine große Herausforderung, die Gewässer in einen ökologisch intakten Zustand zu überführen. Es sind weiterhin Anstrengungen erforderlich, um das Ziel der europäischen Wasserrahmenrichtlinie zu erreichen und bis 2027 für alle Fließgewässer einen guten ökologischen Zustand oder ein gutes ökologisches Potenzial zu erzielen. Von 2018 bis 2021 waren erst 9,4 Prozent der Fließgewässer in Nordrhein-Westfalen in einem guten ökologischen Zustand bzw. verzeichneten ein mindestens gutes Potenzial. Stickstoff- und Phosphateinträge durch Landwirtschaft und Abwässer belasten nach wie vor viele Gewässer. Zu viel Phosphateintrag kann zum „Umkippen“ von Gewässern führen. Zu viele Stickstoffverbindungen schaden den Ökosystemen und fördern so den Artenverlust und die Lachgasentwicklung. Auch jenseits von Phosphor und Nitrat sind viele Gewässer belastet. Nordrhein-Westfalen verfolgt zur Reduzierung des Mikroschadstoffeintrags seit langem umfassende Ansätze – von den Eintragsquellen bis hin zu nachgeschalteten Maßnahmen an Kläranlagen. So konnten in den vergangenen Jahren zum Stand 31.12. 25 Kläranlagen mit einer vierten Reinigungsstufe zur Reduzierung des Eintrags von Mikroschadstoffen ausgebaut und in Betrieb genommen werden. Weitere sind in Bau und Planung.
Natürlicher Klimaschutz
Intakte Ökosysteme sind unverzichtbare Klimaschützer. Wälder, Böden, Moore, Gewässer sowie naturnahe Grünflächen binden CO₂ aus der Atmosphäre und speichern es. Sie wirken zudem als natürliche Puffer gegen Klimafolgen, indem sie Hochwasser aufnehmen und bei Hitze für Abkühlung sorgen. Gleichzeitig sichern sie unsere Lebensgrundlagen, bieten Lebensräume für Tiere und Pflanzen und speichern Wasser.
Moore galten lange als wertlose Flächen – inzwischen ist ihre enorme Bedeutung anerkannt. Als Kohlenstoffsenke, wie auch Auenlandschaften, tragen sie entscheidend zum Klimaschutz bei, sie halten Wasser zurück, puffern Niederschlagsextreme ab und bieten wertvolle Lebensräume für hochspezialisierte Tier- und Pflanzenarten. Mit Hilfe von EU- und Bundes-Fördermitteln und den vom Land finanzierten Biologischen Stationen konnten bereits wichtige Moorflächen reaktiviert, etwa im Großen Torfmoor im Kreis Minden-Lübbecke, und Gewässerauen (z.B. der Lippeaue) renaturiert werden.
Zusätzlich wird das Regionalbüro Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz (ANK), das ab Oktober im Landesumweltamt seine Arbeit aufnimmt, für einen zusätzlichen Schub bei der Verbindung von Klimaschutz und Naturschutz sorgen.
Artenvielfalt
Erfolge gibt es bei Tierarten, deren Bestand sich durch gezielte Schutzprogramme wieder erholen kann, darunter sind etwa Lachse, Weißstörche, Wildkatzen, Feldhamster, Laubfrösche und Wiesenweihen zu nennen. Insgesamt aber nimmt die Artenvielfalt global weiter ab, auch ehemals häufige Arten geraten unter Druck. Der Indikator „Artenvielfalt und Landschaftsqualität“ zeigt einen negativen Trend in allen Lebensräumen – von Wäldern über Agrarland bis hin zu Siedlungen und Gewässern. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, schreibt Nordrhein-Westfalen die landesweite Biodiversitätsstrategie seit dieser Woche in einem neuen, frühzeitigen Konsultationsprozess fort.
Umweltbelastung und Lebensmittel
Gute Nachrichten sind im Bereich der Dioxin- und dioxinähnlichen PCB-Werte zu verzeichnen: Die Belastung von Rohmilch aus Nordrhein-Westfalen ist auf ein sehr niedriges Niveau gesunken. Alle aktuell gemessenen Konzentrationen liegen unter den EU-Höchstgehalten für Dioxine und dioxinähnliche PCB. Auch die radioaktiven Cäsium137-Belastungen in Milch- und Rindfleischproben sind so gering, dass sie kaum noch nachweisbar sind.